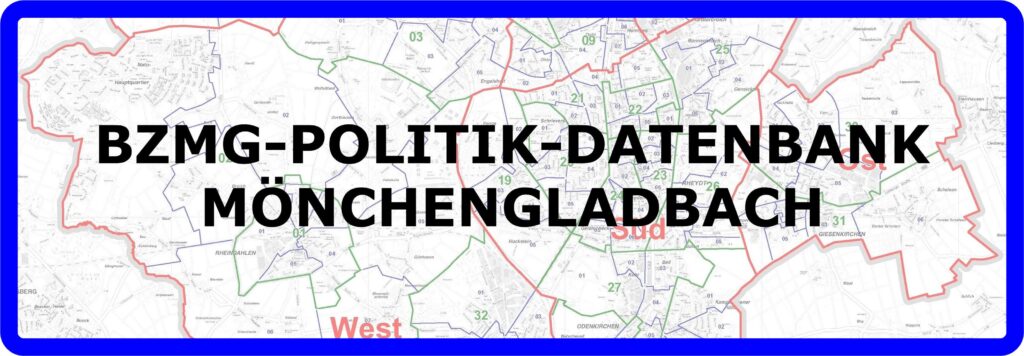Auch wenn die Tagesordnung für die Konstituierende Ratssitzung noch nicht feststeht, dürfte es für den Kern, nämlich die Schaffung der Grundlagen für die Arbeit des Stadtrates und seiner Ausschüsse schon einige Vorarbeiten gegeben haben.
Zur Konstituierenden Sitzung der auslaufenden Wahlperiode am 04.11.2020 hatte das so genannten „Sitzungspaket“ einen Umfang von 185 Seiten und beinhaltete neben der Einbringung des Doppelhaushaltes 2021/2022 (5 Tagesordnungspunkte) ca. weitere 40, die einen Bezug zu den Grundlagen für die Arbeit des Stadtrates hatten.
Zwei Themenbereiche nahmen damals einen breiten Raum ein und dürften auch am 05.11.2025 prioritär sein:
- Bildung und Besetzung von Ausschüssen und „Zugriff“ auf Ausschussvorsitze
- Wahl der Mitglieder von Aufsichtsgremien für Gesellschaften und Organisationen mit städtischer Beteiligung
Dazu, was bei diesen Themenbereichen zu beachten ist, schreibt die Gemeindeordnung NRW (GO NRW) teilweise sehr dezidiert vor.
Bildung und Besetzung von Ausschüssen
Für die Wahlperiode 2020 bis 2025 wurden die Ausschüsse beschlossen, wie sie derzeit noch existieren.
Bis auf die Installation des „Ausschusses für Chancengerechtigkeit und Integration“ („Integrationsausschuss“) als Nachfolger des Integrationsrates sind keine weiteren Änderungen zu erwarten.
Für die Besetzung der Ausschüsse machen die Fraktionen ihre namentlichen Wahlvorschläge (Ausschussmitglieder und stellv. Mitglieder).
Sollten sich nicht alle Fraktionen darauf verständigen, die Wahlvorschläge der übrigen Fraktionen zu akzeptieren, wird über die Wahlvorschläge aller Fraktionen einzeln abgestimmt.
Bei Letzterem können sich einzelne Fraktionen zu Listen (Zählgemeinschaften) zusammenschließen, um sicherzustellen, dass ihre Wahlvorschläge zum Tragen kommen.
Für die aktuelle politische Konstellation im Rat könnten zum Thema „Listenverbindungen“ diese Gerichtsurteile eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen:
Listenverbindungen sind nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nur zulässig, wenn sie unter Beachtung des politischen Kräftespektrums im Rat erfolgen und nicht zum Nachteil einer anderen Fraktion oder Gruppe gehen, die nicht an der Listenverbindung beteiligt ist.
Bei der Besetzung der Ausschüsse sind deshalb – zur Erlangung eines zusätzlichen Sitzes gebildete – gemeinsame Vorschläge mehrerer Fraktionen zum Nachteil anderer Fraktionen unzulässig (BVerwG, Urteil vom 10.12.2003 – 8 C 18/03 -, NVwZ 2004, 621).
Ein Zusammenschluss von Ratsmitgliedern mehrerer Fraktionen im Sinne des § 56 Abs. 1 GO bei der Verteilung der Ausschusssitze nur zulässig, wenn dieser Zusammenschluss zu einer verfestigten Zusammenarbeit auf einer gemeinsamen politischen Zielsetzung basiert.
Daraus folgt, dass eine zulässige Listenverbindung von einer unzulässigen Zählgemeinschaft durch die Ernsthaftigkeit und Dauerhaftigkeit der Zusammenarbeit abzugrenzen ist.
Eine unzulässige Zählgemeinschaft liegt vor, wenn sie ad hoc allein zur Erlangung eines zusätzlichen Ausschusssitzes zu Lasten anderer, nicht an der Zählgemeinschaft beteiligter Fraktionen oder Gruppen gebildet wird.
Hiervon ist der auf dauerhafte Zusammenarbeit angelegte Zusammenschluss mehrerer Fraktionen im Rat zu unterscheiden.
Eine Einzelfallbetrachtung ist unerlässlich.
Es müssen hinreichende Tatsachen bestehen, die den Schluss zulassen, dass die Zusammenarbeit von Fraktionen auf Grundlage eines gemeinsamen politischen Konzepts erfolgt und dauerhaft sein soll (OVG Niedersachsen, Beschluss vom 04.02.2005 – 10 ME 104/04 -, NdsVBl 2005, 236-239).
Die Urteile könnten nicht nur für die Besetzung von Ausschüssen Bedeutung haben, sondern auch für die „Zugriffe“ von Fraktionen auf die Ausschussvorsitze, die in Teil 9 und Teil 9A dieser Themenreihe in vier denkbaren Szenarien zur Diskussion gestellt wurden.
Sollte sich eine Fraktion im Mönchengladbacher Stadtrat benachteiligt fühlen, könnte das zu erheblichen Diskussionen in der Konstituiernden Sitzung führen.
Würde diese dann nicht mit einem Konsens enden, könnte es zur Anrufung der Kommunalaufsicht und/oder einer Klage vor dem Verwaltungsgericht in Düsseldorf kommen.
Mitglieder von Aufsichtsgremien für Gesellschaften usw. mit städtischer Beteiligung
Kommunen dürfen privatwirtschaftlich organisierte Gesellschaften nur gründen oder sich daran beteiligen, wenn Aufgaben aus der kommunalen Daseinsvorsorge der Kommune abgeleitet bzw. von dieser übernommen werden.
Beispiele sind die Straßeninstandhaltung, Grünpflege usw. durch die mags AöR und die Abfallentsorgung durch die GEM mbH.
Die GO NRW schreibt vor, dass der Oberbürgermeister/Hauptverwaltungsbeamter „qua Amt“ Mitglied im Aufsichtsrat sein muss (GO NRW § 113).
Im Übrigen gelten die Gesellschafterverträge der einzelnen Beteiligungsunternehmen.
Eine Ausnahme bildet der Verwaltungsrat der Stadtsparkasse Mönchengladbach (SSK).
Dessen Vorsitzender wird explizit vom Stadtrat gewählt, wie auch die Verwaltungsratsmitglieder, die darüber hinaus auch Mitglied in diversen Unterausschüssen des Verwaltungsrates sein können.
In wieweit die o.g. Urteile der Verwaltungsgerichtsbarkeit auch für die SSK gelten wäre, noch zu prüfen.





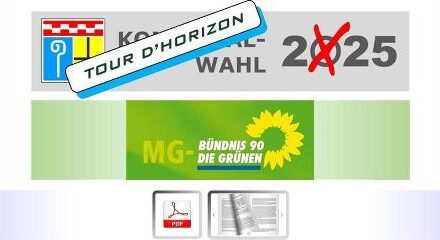

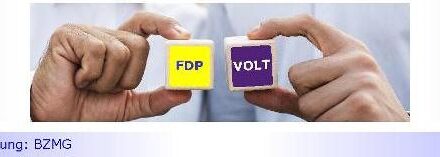




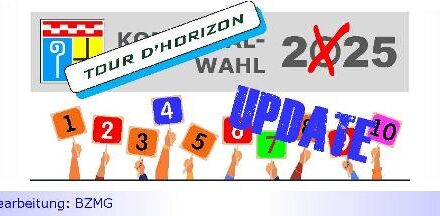
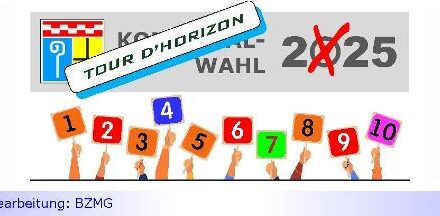


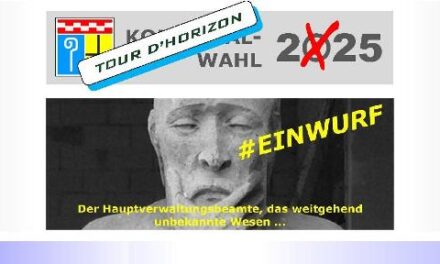



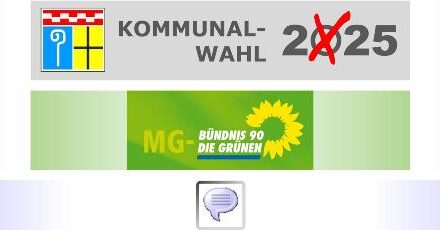
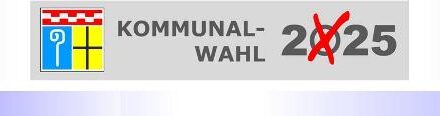
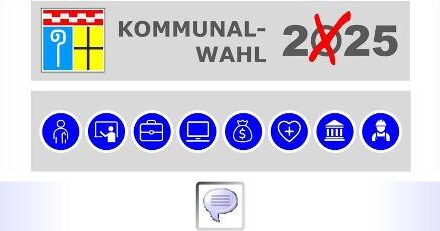

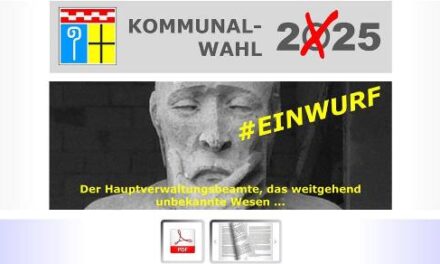


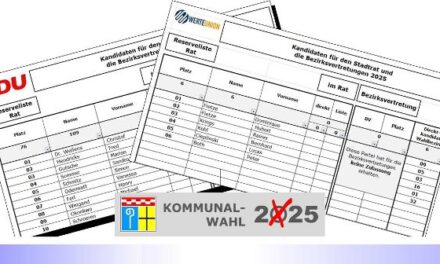
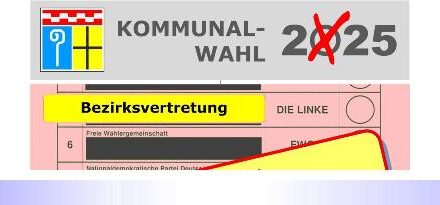
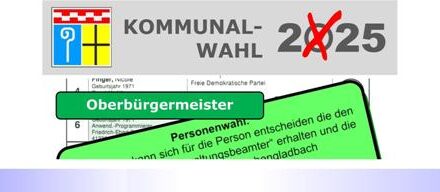


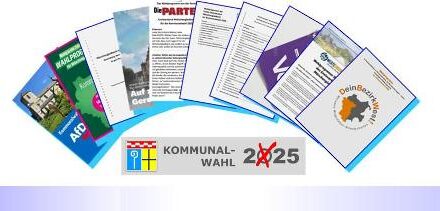

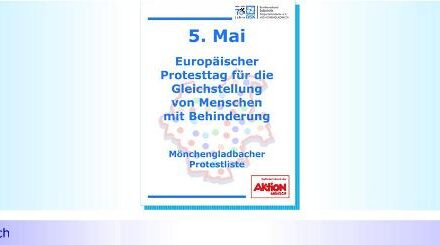
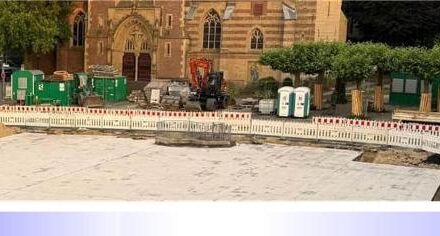





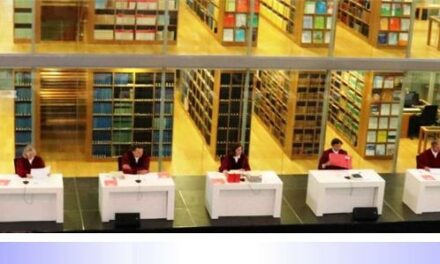

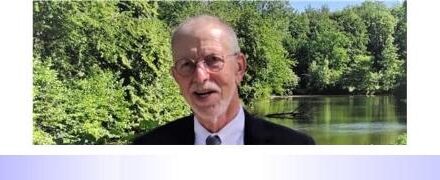
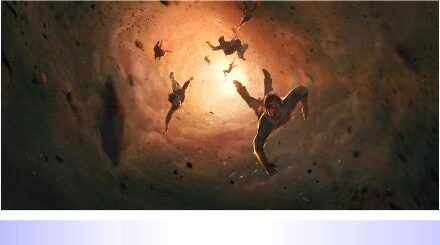

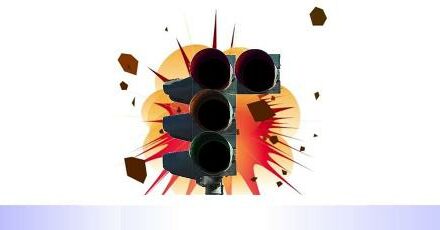



![Teil IV: Spannungsfelder [BZMG 1.0]](https://news.bz-mg.de/wp-content/uploads/bb-denker-2024-820-440x264.jpg)