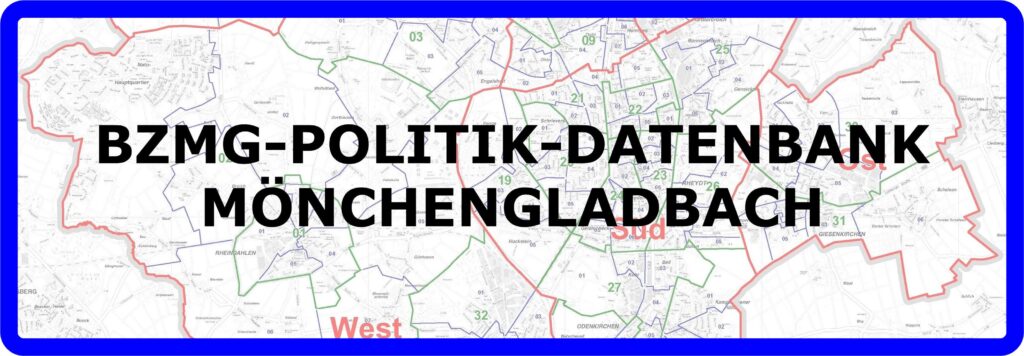Vor fünf Jahren waren die Grünen in Mönchengladbach so stark wie nie zuvor.
Ihr OB-Kandidat Dr. Boris Wolkowski erreichte 2020 fast 19% der Stimmen und galt damit als ernstzunehmender Herausforderer der etablierten Kräfte.
Damals schien es, als könnten die Grünen auch in einer traditionell konservativen Stadt zur prägenden politischen Kraft aufsteigen.
2025 ist davon nichts mehr zu spüren.
Der „neue“ OB-Kandidat Marcel Klotz kam bei der Wahl am 14. September auf nur 3,49% – weniger als die Linke und nur knapp vor dem Satirebewerber von „Die PARTEI“.
Besonders ernüchternd: Selbst das schwache Stadtratsergebnis der Grünen (8,6%) konnte er nicht annähernd erreichen.
Ein Kandidat, der die Partei eigentlich beflügeln sollte, wurde damit möglicherweise zum „Klotz“ am Bein.
Fünf Wahlen – eine Achterbahnfahrt
- 2004: Karl Sasserath erreichte 7,70 %, damals noch hinter dem FDP-Kandidaten (8,82%)
- 2009: Die Grünen traten erneut mit Karl Sasserath, der fast gleichauf mit dem FDP-Kandidaten 6,31% errang
- 2014: Mit Karl Sasserath gelang auch diesmal mit 7,1% ein Achtungserfolg. Für grüne Verhältnisse solide, aber weit von der Stichwahl entfernt.
- 2020: Die große Ausnahme: Dr. Boris Wolkowski profitierte von der bundesweiten Klimadebatte, Fridays for Future und einem grünen Hoch, das die Partei bis auf fast 19 Prozent katapultierte. Für einen Moment schien sogar in Mönchengladbach vieles möglich.
- 2025: Der Absturz: Mit 3,49 Prozent landete Marcel Klotz auf einem historischen Tiefstand – rund 15 Prozentpunkte unter seinem Vorgänger – und sogar weit unter den Ergebnissen von 2004, 2009 und 2014.
Interne Debatten im Vorfeld
Weit im Vorfeld der Kommunalwahl 2025 wurde innerhalb der Grünen über eine ungewöhnliche Option spekuliert: den Verzicht auf eine eigene OB-Kandidatur.
Hintergrund war die damals noch funktionierende Ampel-Kooperation mit SPD und FDP.
Ein kleiner Teil der Partei erwog, den amtierenden SPD-Oberbürgermeisterkandidaten zu unterstützen, um Geschlossenheit und „Regierungsfähigkeit“ der Ampel zu demonstrieren.
Doch diese Überlegung wurde intern rasch verworfen.
Die damalige Co-Fraktionsvorsitzende der Grünen, Ulla Schmitz, sprach sich in einer Mitgliederversammlung vehement für einen eigenen OB-Kandidaten aus.
Ein Verzicht, so ihre Argumentation, würde die Grünen unsichtbar machen und die Eigenständigkeit der Partei untergraben.
Damit war der Weg frei für einen eigenen grünen OB-Kandidaten, später dann für Marcel Klotz und den viel späteren Absturz.
Ursachen des Niedergangs
Die denkbaren Gründe für den dramatischen Einbruch bei der OB-Wahl sind vielfältig:
- Überzogene Erwartungen? Klotz hatte das Ziel ausgegeben, es in die Stichwahl zu schaffen. Angesichts der politischen Mehrheitsverhältnisse wirkte das auf viele Wähler realitätsfern.
- Fehlende Verankerung? Während Sasserath über Jahre als Fraktionschef und Bezirskvorsteher bekannt und parteiübergreifend respektiert war, blieb Klotz weitgehend unsichtbar. Viele grüne Stammwähler verzichteten offenbar bewusst auf ein OB-Kreuz.
- Bundespolitisches Klima? Nach schwierigen Jahren in Berlin sind die Grünen auch auf kommunaler Ebene unter Druck geraten. Unpopuläre Debatten zu Energie- und Verkehrspolitik färbten auf die Wahrnehmung der lokalen Kandidaten ab.
- Kommunikative Schwäche? Statt die Wahl als Chance zu nutzen, ein eigenes, realistisches Profil aufzubauen, führte man nach dem Bruch der Mönchengladbacher „Ampel“ eine formloses Kooperation mit der SPD fort, verlor sich der Wahlkampf in symbolischen Botschaften – während die SPD und deren OB-Kandidat die „Ampel-Erfolge“ für sich „vermarkten“ konnte.
- Unzureichende Unterstützung durch die Partei? Innerhalb der Grünen fehlte offensichtlich die volle Rückendeckung.
Klotz wirkte nicht wie der gemeinsame Spitzenmann, sondern eher wie eine Pflichtnominierung. - Zu frühe Nominierung ohne Programm? Klotz wurde aufgestellt, als das Kommunalwahlprogramm noch nicht einmal im Ansatz vorlag. Damit fehlte ihm über Monate die inhaltliche Grundlage, um eigene Akzente zu setzen oder Wahlkampfthemen glaubwürdig zu personalisieren.
Klotz‘ Versuche, die Mängel in der Verwaltung dem amtierenden SPD-OB-Kandidaten zuzuschreiben, mussten scheitern, weil die Grünen (und Klotz selbst) das Handeln dieses OB-Kandidaten durchgehend kritiklos unterstützt (mindestens jedoch) toleriert hatten.
Diese Positionierung dürfte jedoch ihm, seiner Partei und dem in der Stichwahl obsiegenden Oberbürgermeisterkandidaten von SPD oder CDU „auf die Füße fallen“.
Denn dann müssen sie sich in den kommenden fünf Jahren mit den Vorstellungen der AfD im Rat, in den Ausschüssen und den Bezirksvertretungen auseinandersetzen – ob sie wollen oder nicht.
Konsequenzen
Für die Grünen in Mönchengladbach wird sich nun die strategische Frage stellen: Lohnt sich eine eigene OB-Kandidatur überhaupt noch?
Die Bilanz spricht dagegen: Nur 2020, im bundesweiten Höhenflug, gelang es, über den eigenen Parteikern hinaus Wähler zu gewinnen.
In allen anderen Wahlgängen blieben die Ergebnisse einstellig oder fielen – wie 2025 – sogar ins Bodenlose.
Will die Partei künftig wieder ernsthaft eine OB-Kandidatur ins Auge fassen, braucht es mindestens drei Voraussetzungen:
- Eine glaubwürdige Persönlichkeit, die in der Stadtgesellschaft verankert ist, jedoch (noch) nicht identifizierbar ist.
- Realistische Zielsetzungen, die Vertrauen schaffen, statt Erwartungen zu enttäuschen.
- Thematische Fokussierung auf kommunale Alltagspolitik – mit Programm und Rückhalt der gesamten Partei, nicht als Soloprojekt.
Fazit
Die Grünen in Mönchengladbach erleben bei OB-Wahlen einen dramatischen Zyklus zwischen realpolitischer Kontinuität, Ausnahmehoch und Absturz.
Die abgelehnte Debatte über einen Verzicht zugunsten des SPD-Kandidaten zeigt im Rückblick, dass Realpolitik womöglich klüger gewesen wäre.
Dass Marcel Klotz zu früh nominiert und unzureichend unterstützt wurde, verstärkte den Absturz zusätzlich.
Nach 2025 dürfte klar sein: Ohne eine personell und strategisch neue Ausrichtung bleiben eigene OB-Kandidaturen nicht Chance, sondern nur Risiko.

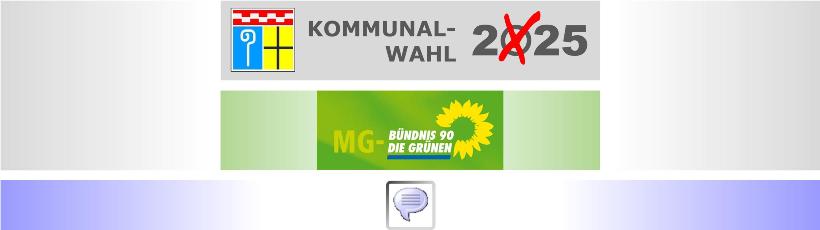
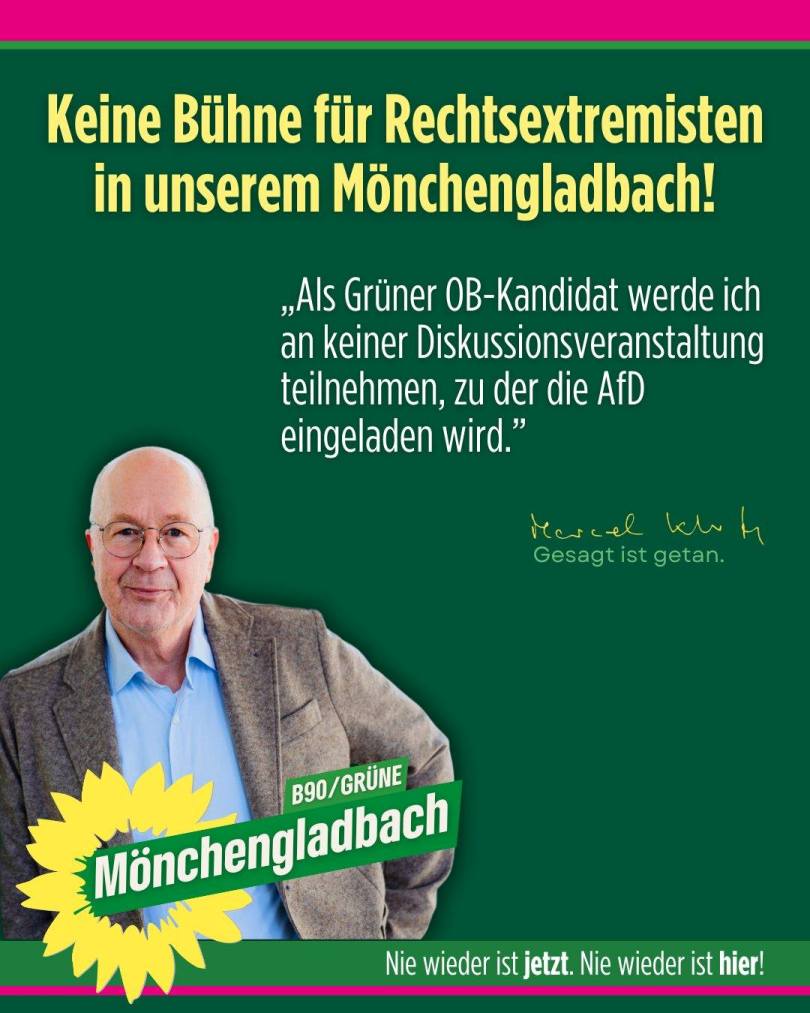

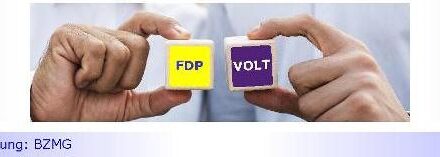




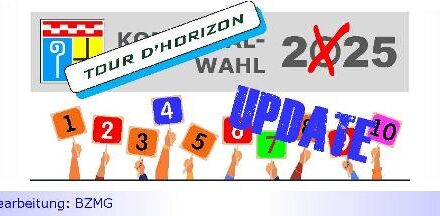
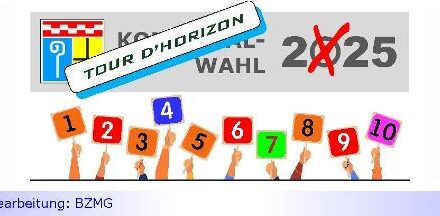


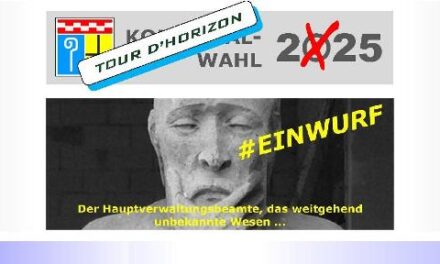



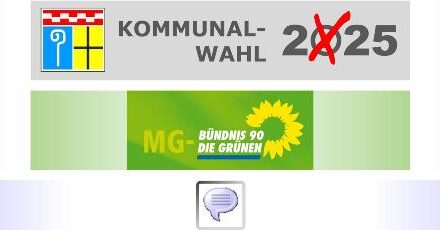
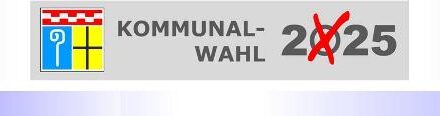
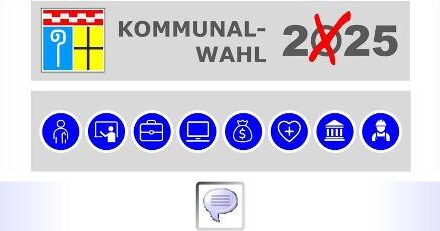

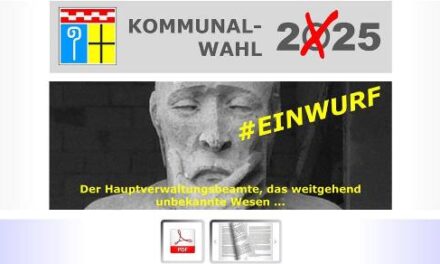


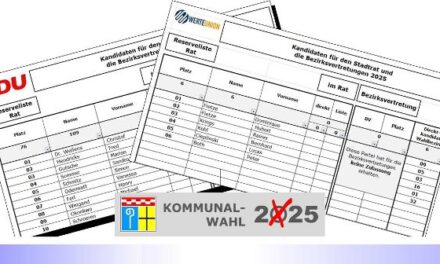
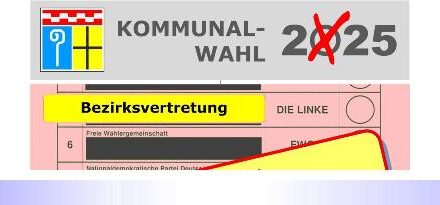
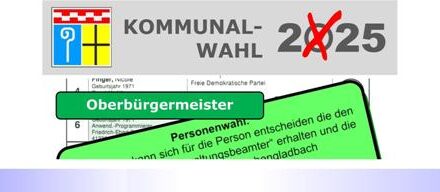


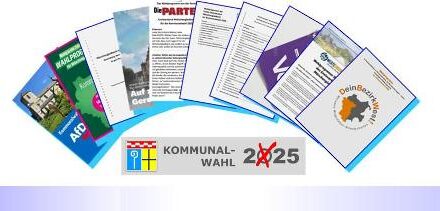

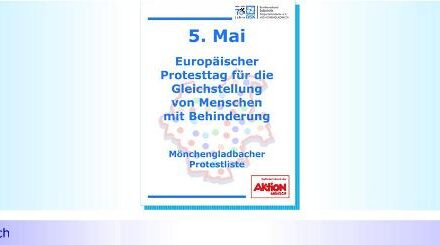
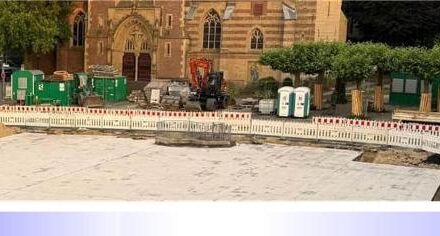





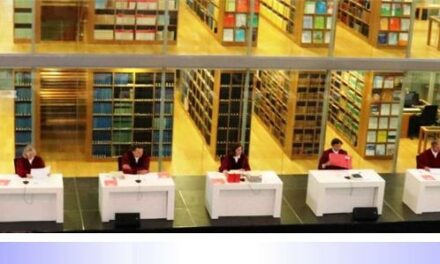

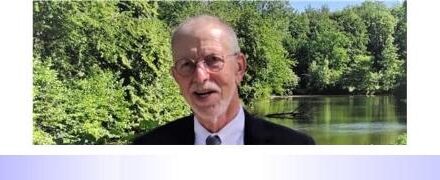
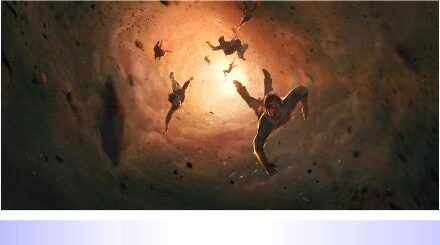

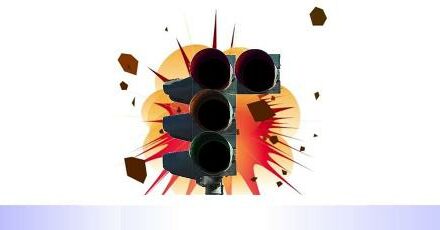



![Teil IV: Spannungsfelder [BZMG 1.0]](https://news.bz-mg.de/wp-content/uploads/bb-denker-2024-820-440x264.jpg)